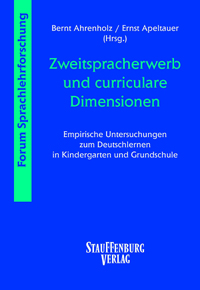|
Die Beiträge
des Bandes gehen überwiegend auf Vorträge zurück, die auf dem 15. Symposion
Deutschdidaktik im Jahre 2004 in Lüneburg in der Sektion Deutsch als Zweit-
und Fremdsprache gehalten
wurden. Es werden Einblicke gegeben in Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten über
-
Lernvoraussetzungen und
Sprachentwicklungsprozessen bei Kindern mit
Migrationshintergrund,
-
Verfahren zur Erfassung von Sprachgebrauch
in Migrantenfamilien,
-
Bestimmung von Sprachentwicklungsständen,
-
neue Konzeptionen im Bereich der
Fremdsprachenfrühförderung.
Alle Beiträge
fokussieren Spracherwerbs- und -lernprozesse im Kindergarten bzw. in der
Grundschule. In den letzten beiden Texten werden Sprachlehr- und
-lernsituationen thematisiert, in denen Kinder im Ausland Deutsch lernen.
Über ein zweisprachig aufwachsendes
russisch-deutsches Kind und seine sprachliche Entwicklung berichtet Adybasova anhand einer Fallstudie.
Beschrieben werden Mutter-Kind- und Kind-Kind-Interaktionen im Rahmen eines
Mutter-Kind-Sprachkurses im Kindergarten. Der Beitrag von Kuyumcu fokussiert häusliche
Interaktionen zwischen Mutter und Kind bei zweisprachig aufwachsenden
Vorschulkindern mit Türkisch als Erst- und Deutsch als Zweitsprache.
Untersuchungsergebnisse zum Wortschatzerwerb und zur Bedeutungsentwicklung bei
sprachlich geförderten deutsch-türkischen Vorschulkinder werden von Apeltauer erörtert.
Die reale
Sprachenvielfalt im Schulalltag ist Gegenstand der „Sprachenerhebung Essener
Grundschulen“ (SPREEG). Chlosta und
Ostermann diskutieren in ihrem
Beitrag methodische Probleme einer solchen auf Fragebogen basierenden Erhebung.
Zur Erfassung von Sprachkompetenzen von Schülern mit Migrationshintergrund wird
von Grießhaber das von ihm
modifizierte Verfahren der "Profilanalyse" vorgestellt. Ahrenholz berichtet über Ergebnisse aus
einem DFG-Projekt zum 'Förderunterricht und Deutsch-als-Zweitsprache-Erwerb'. Im
Vordergrund stehen dabei mündliche Sprach- und Erzählkompetenzen. Schließlich
werden im Hinblick auf Schulmodelle und curriculare Aspekte fremdsprachlicher
Frühförderung Einblicke in jüngste schulische Entwicklungen in der Türkei
gegeben und ein neues Modell bilingualer Erziehung (Türkisch und Deutsch) wird
erläutert (Sayınsoy). Der letzte Beitrag von Stasiak beschäftigt sich mit einem
Forschungsprojekt mit Experimentcharakter: Grundschulkinder in Gdansk (Polen)
lernen gleichzeitig Englisch und Deutsch. Zwischenergebnisse aus diesem Projekt
und das dazu entwickelte Curriculum werden vorgestellt.
|